Auszüge aus dem Buch
„Die Hagener Straße“
Herausgeber: Redaktionsteam des Geschichtskreises Letmathe

Die alte Landstraße von Oestrich über Letmathe nach Elsey und Limburg
von Dr. Norbert Hesse
Vor dem Bau der heutigen Hagener Straße, die im Volksmund nach ihrer Fertigstellung im Jahr 1813 auch Kunststraße genannt wurde, verband der alte Königsweg Orte wie Hagen, Limburg/Elsey, Letmathe, Oestrich, Dröschede und Iserlohn1. Schon in früheren Zeiten war sie alte Heeresstraße2 und ab 1782 auch Weg für die königlich preußische Post3.
Auf der wohl ältesten bekannten Karte von Letmathe aus dem Jahre 1776 ist der damalige Verlauf der alten Straße von der Oestricher Mark durch das Dorf Letmathe bis zur Elseyer Mark eingezeichnet. Diese Karte wurde von dem königlich preußisch geschworenen (vereidigten) Feldmesser D. H. Ahmer angefertigt. Sie war wohl ein wichtiges Dokument im Brückenstreit zwischen dem Freiherrn von Brabeck und dem Grafen von Limburg.4 Auf der alten Karte ist die Zahl der Höfe in Genna genau wiedergegeben, dagegen sind die Häuser und Wege in Letmathe nur angedeutet. Dies könnte eine Erklärung dafür sein, dass der Verlauf der alten Landstraße von Iserlohn nach Elsey über die heutige Von-der-Kuhlen-Straße, den Windhügel und weiter über die verlängerte Bachstraße nach Elsey gedeutet wurde.
Wege, die damals Ortsteile miteinander verbanden, waren Hohlwege und zum Teil auch nur Fußwege, an denen Misthaufen lagen und durch die Abwässer flossen. So führte die Fußverbindung nach Oestrich nur über einen schmalen Steg über den Flehmebach; die Fuhrwerke mussten durch den Bach fahren.5
Die Wege waren also in einem jämmerlichen Zustand. Daher wundert es nicht, dass der Limburger Landesherr, Graf Moritz Kasimir, 1786 eine Wegeordnung erließ, die besagte, dass alle öffentlichen Landstraßen und gemeinen Dorfwege in Ordnung zu bringen seien.6
Für diese Zwecke wurde der Verlauf der auszubauenden alten Landstraße von der Elseyer Mark bis nach Oestrich anhand von Richtungspunkten auf einer Vermessungstabelle eigens festgelegt.
Elseyer Markenscheidung: Grenze Hohenlimburg/Letmathe
Gerth: Gelände nördlich der Straße Am Bülzgraben
Mülsgraben: dürfte der Bülzgraben sein, Tal mit Bachlauf südlich von der Straße Am Bülzgraben, später Gelände der alten Müllkippe
Stumpf Heckgoß
Weg am Handweiser
Flößgraben von Jürgensbauer: Graben des Bülzgrabenbaches auf der Höhe der Kreuzung Im Oberdorf/Hagener Str.?7
Pastoratshaus: heutige Pastorat und Pfarramt
Dorfbach: Erbsenbach, der in Höhe der Dechant-Heimann-Straße unter der Hagener Straße von Norden nach Süden und dann in östlicher Richtung fließt
Kirchhof: um die alte Kilianskirche
Gärten von Haus Letmathe: zwischen Haus Letmathe und Kilianskirche
Schulten-Haus
Jürgen Metzelers Haus: an der Von-der-Kuhlenstraße, Höhe ehem. Gaststätte Höhle
Klusenstück
Klusemanns-Haus
Flemebach
Eine alte Karte aus dem Jahre 1797 bestätigt nicht nur im Großen und Ganzen die Richtpunkte der Vermessungstabelle, sondern zeigt auch in anschaulicher Weise den Verlauf der ausgebauten Landstraße in den Jahren nach der amtlichen Wegeverordnung des Grafen von Limburg aus dem Jahre1786.8
Darüber hinaus beschreiben spätere Aufzeichnungen eines Wanderers, festgehalten in dem Artikel „Ein Gang durch Letmathe im Jahre 1800”, eindrucksvoll den Verlauf der alten Landstraße. Die Schilderung des Wanderers beginnt im damaligen „Unterdorf“, das es vor etwa 200 Jahren noch gar nicht gab.9 Von Oestrich der alten Heerstraße nach Limburg und Elsey folgend, führte damals der Weg über eine Alleestraße, die heutige von-der-Kuhlen-Straße, an Wiesen und Gärten vorbei auf einen Hohlweg, die heutige Schwerter Straße, zu. Hier überquerte die Landstraße den Hohlweg und verlief geradeaus zwischen dem Wirtshaus Liese (abgebrochen 1976 für den Ausbau der Kreuzung Schwerter Straße / Hagener Straße) und der Mauer des Gutes von Brabeck auf die alte Mühle von Haus Letmathe, die spätere Gaststätte Finger-Humpert (abgebrochen im Jahre 1976) zu. An der alten Mühle vorbei führte die Verkehrsstraße zwischen dem alten Pehlschen Hause (Mündung Oeger Straße/Hagener Straße) und dem rechts davon befindlichen Degeschen Haus (abgebrochenen 1939) Richtung Kolpingstraße durch das Bett des Erbsenbaches. Auf der nördlichen Seite des Erbsenbaches lagen die Gärten des Hauses Letmathe und entlang der südlichen Seite des Erbsenbaches befand sich der alte Friedhof.
Über die heutige Kolpingstraße hinaus ging es weiter bis zur Höhe der jetzigen Dornhoffschen Besitzung in der Bachstraße (früher altes Letmather Krankenhaus). Hier machte die alte Verkehrsstraße eine Biegung nach links über Hof und Einfahrt der ehemaligen Schulten-Schmiede durch die Besitzung des Land- und Gastwirtes Schlüter (heute Haus Höynck).
Damals gab es zwei Möglichkeiten, von der Gaststätte Schlüter weiter nach Westen zu gelangen. Zum einen führte ein Weg am Bauernhof Grote vorbei, um dann etwa dem Verlauf der heutigen Hagener Straße bis zum Marienhospital (damals noch nicht gebaut) zu folgen. Zum anderen bestand eine Fuhrverbindung von der Gaststätte Schlüter (Höynck) über die Heinrichstraße und den ersten Teil der Straße Im Oberdorf bis zur Mündung auf die jetzige Hagener Straße in Höhe des Marienhospitals.10
Von dieser Kreuzung aus verlief die alte Landstraße etwa parallel der Hagener Straße, aber leicht nach Norden abgewinkelt in Richtung des Geländes der alten Gärtnerei Bonnekoh (Gelände südlich des ev. Friedhofs) und überquerte dabei Teile der Humpfertstraße, des Grünen Busches und der Friedhofstraße. Hinter der ehemaligen Besitzung Bonnekoh gabelte sich die Landstraße. Wer nach Limburg wollte, nahm die Wegverbindung an dem Gelände des späteren neuen katholischen Friedhofs vorbei über den Steltenberg. Wer nach Elsey wollte, fuhr zunächst über einen Hohlweg nördlich unterhalb des alten Schlotmannschen Hauses und etwas südlich der heutigen Straße Am Bülzgraben durch das alte Siepen, folgte dann etwa dem Verlauf der heutigen Privatstraße der Firma Giebel in Richtung der Hohenlimburger Möller-Straße ins Dorf und zum Stift Elsey.11, 12, 13
Diese alte Verkehrsverbindung von Elsey durch Letmathe nach Iserlohn bestand oft nur aus einfachen Hohlwegen, die meistens voller Geröll14 lagen und besonders an regnerischen Tagen und zur Winterzeit nur schwer befahrbar waren.15
So ist es nicht verwunderlich, dass bereits 10 Jahre nach der Instandsetzung der Landstraße im Jahre 1787 über eine teilweise neue Wegführung und eine besser ausgebaute Verkehrsstraße nachgedacht wurde. Auf der Karte aus dem Jahre 1797 sind Vorschläge für den Ausbau einer solchen Maßnahme eingezeichnet.
Aber erst in der napoleonischen Zeit, infolge der stetigen gewerblichen Entwicklung des heimischen Raumes, wurde in den Jahren 1811 bis 1813 die jetzige Hagener Straße gebaut.
1 Esser, Hermann: Die Poststraße von Hagen nach Iserlohn. In: Heimatblätter für Hohenlimburg und Umgebung. 5. Jahrgang Juni 1931. Heft Nr. 6. S. 87/88.
2 Ewig, Walter: Der Königsweg. Iserlohn, 1951. Karte im Anhang
3 Esser, Hermann: Heimische Straßengeschichte. 1. Die Chaussee von Hagen nach Iserlohn. In: Heimatblätter für Hohenlimburg und Umgegend. 7. Jahrgang, Heft Nr. 8. August 1933. S. 116/117.
4 Letmather Nachrichten (Hrsg.): Letmathe 950 Jahre. Letmathe, 1986. S. 21.
5 Weber, Werner: Nur ein freier Bauernhof in Letmathe, Haus Letmathe mit Gräfte und Zugbrücke. In: Letm. Nachr. 20. Dezember 1978.
6 Weber,Werner: Markenbesitzer mußten Landstraße ausbauen. In: Letmather Nachrichten, 27.August.1975
7 Schulte, Gerd: Anlage einer Abfahrt für den Ökonom Friedrich Wildschütte zu Letmathe, 13.06.1881
8 Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Staatsarchiv Münster; alte Karte aus dem Jahre 1797
9 Ein Gang durch Letmathe vor 150 Jahren. In: Heimann, Karl: Heimatbuch Letmathe. Bigge / Ruhr, 1950. S. 74 f. Auch abgedruckt unter dem Titel „Ein Gang durch Letmathe um 1800” in den Letmather Nachrichten in den Jahren 1936 und 1988.
10 Katasteramt Lüdenscheid: Katasterkarten von Letmathe aus dem Jahre 1821, Section D
11 Weber, Werner: Nur ein freier Bauernhof in Letmathe, Haus Letmathe mit Gräfte und Zugbrücke. In: Letmather Nachrichten. 20. Dezember 1978.
12 Geometer Jüngst: Gemeindekarte von Letm. aus dem Jahre 1821
13 Katasteramt Lüdenscheid: Katasterkarte von Letmathe aus dem Jahre 1821, Section D
14 Korte, Gustav: Erinnerungen eines alten Letmathers. Letmather Nachrichten. Januar 1936.
15 Ein Gang durch Letmathe vor 150 Jahren. In: Heimann, Karl: Heimatbuch Letmathe. Bigge / Ruhr, 1950. S. 74 f. Auch abgedruckt unter dem Titel „Ein Gang durch Letmathe um 1800” in den Letmather Nachrichten in den Jahren 1936 und 1988
Bildergalerie „Die Hagener Straße“
Die Hagener Straße – ein kurzer Abriss ihrer Geschichte
von Katja Hofbauer, M.A
Die Hagener Straße, heute die Haupteinkaufsstraße Letmathes, ist aus dem Lennestädtchen nicht mehr wegzudenken. Und doch ist sie – gemessen an der mehr als 960-jährigen Geschichte der Stadt – eine recht junge Straße.
In alter Zeit dominierte die uralte Königsstraße, von Limburg kommend und nach Oestrich führend, den Verkehr im Dorf. Diese Straße wurde ab 17821 auch als Postweg genutzt. Die heutige Hagener Straße kürzt diesen Zickzack ab und führt ein Stück parallel zur alten Straße, um dann Richtung Grüne abzubiegen. Die heutige Hagener Straße ist also geradliniger als ihre Vorgänger und ist tatsächlich eine relativ junge, künstlich angelegte Straße, die nur teilweise mit den alten Wegen übereinstimmt.
Der Zustand der alten Straße war schlecht, im Frühjahr und Herbst war sie kaum passierbar. 1790 unterbreitete die limburgische Kanzlei dem Landesherren Fürst Moritz Casimir zu Bentheim-Tecklenburg den Antrag zum Ausbau der Verbindung nach Iserlohn, da diese Straße „eine der frequentiertesten ganz Deutschlands“2 wäre. 1797 und 1800 erneuerte die Kanzlei diese Anträge, die Generaldirektion in Berlin handelte allerdings nicht – die Regierung war durch die Kriege gegen Frankreich zu sehr abgelenkt. Auch die Landstände, besonders der Freiherr von Brabeck, verhinderten zunächst den Ausbau. 1803 fand erneut in Limburg eine Sitzung in Sachen Chausseebau statt und 1805 teilte „die Kanzlei dem Grafen in Rheda mit, dass nach einem Schreiben der Kriegs- und Domänenkammer zu Hamm vom 27. Dezember 1803 die Anlage der geplanten Chaussee sehr wahrscheinlich sei und nur die Frage der Geldbeschaffung noch zur Erörterung stehe.“3 Doch dann marschierten die Franzosen in Westfalen ein und besetzten es, der Chausseebau verzögerte sich erneut. Erst in der Zeit der französischen Besatzung wurde der Bau der Kunststraße begonnen, der Freiherr vom Stein hatte wohl maßgeblich dazu beigetragen.4 1807 heißt es in einer Urkunde: „Ihre Hochgr. Gnaden und die Stände der hiesigen Grafschaft sind in dem letzten Landtage einsgeworden, dass auf Landeskosten und –kredit zwischen Hagen und Hemer eine Chaussee durch die Grafschaft Limburg angelegt (…) solle.“5
Ein wichtiger Grund für den Neubau dieser Kunststraße: Es gab immer mehr durchfahrende Schnellpostwagen, die nicht nur die Post transportierten, sondern auch Personen beförderten. Dazu wurden gute Straßen benötigt. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts wurden deshalb verstärkt Straßen in Westfalen gebaut. Da viele Postkutschen ihren Weg über die Posthalterei Schlünder in Wimbern (als einer der bedeutendsten Posthaltereien im Bereich der Oberpostdirektion Arnsberg6) nahmen, liefen dort auch viele Straßen zusammen. Unter anderem eben jene Hagen-Wimberner-Chaussee, die ein Stückchen durch Letmathe führte. Offiziell führte sie im 19. Jahrhundert den Namen Barmen-Hagen-Wimberner Provinzialstraße.
Vom Frühjahr 1808 an wurde also – unter Franzosenherrschaft – dieser Straßenbau vollendet. Gebaut hat die Straße der großherzoglich- bergische Staat – der junge Großherzog war ein Neffe Napoleons.7 1812 war die Straße in Letmathe einigermaßen fertig. Richtig fertig gestellt wurde die Chaussee dann bis ins Jahr 1813 hinein,8 einige Arbeiten zogen sich – besonders im Teilstück zwischen Hagen und Menden – bis 1820 hin.9 Beim Ausbau der Straße wurden einige Teilstrecken anders verlegt: „Bis Letmathe kam nur eine teilweise Verlegung der Straße in Frage, daneben selbstverständlich eine umfassende Verbreiterung und Befestigung. Im weiteren Verlauf sollte die Linie nicht der alten Poststraße folgen, sondern durch das Tal der Grüne gelegt werden, das bisher dem durchgehenden Verkehr verschlossen war. Am Eingang des Grünetals würde dann die Straße nach Altena abzweigen, um die weitere Benutzung des schwierigen Höhenweges unnötig zu machen.“10 Die neue Straße hieß in Letmathe zunächst „Chaussee nach Iserlohn“ oder „Limburger Chaussee“, 1904 erst bekam sie im Ort den offiziellen Namen „Hagener Straße“. Offiziell war sie Teil einer Staatsstraße, der Reichstraße 7, später Bundesstraße 7. Die Hagener Straße, die anfangs nur ein Verbindungsweg mit überregionaler Bedeutung und weniger ein Verkehrsweg innerhalb des Ortes war, entwickelte sich im 19. und 20. Jahrhundert zur Hauptstraße Letmathes.
Das wirtschaftliche Zentrum Letmathes war zunächst – wie bisher – der „Alte Markt“, der Platz an der Kreuzung Hagener Straße / Schwerter Straße. Das war der Knotenpunkt zweier wichtiger Handelsstraßen, kein Wunder, dass sich an diesem Platz zahlreiche Gaststätten (zum Beispiel Schmale, Humpert und Pieper) im Laufe der Jahrhunderte ansiedelten. Das Zentrum des alten Dorfes verlagerte sich aber nach dem Bau der Hagener Straße langsam weiter in Richtung des heutigen Bahnhofs – erst recht, nachdem die Eisenbahnlinie ab 1859 ihren Weg durch Letmathe fand. Ein Grund für die Verschiebung des Zentrums war auch die zunehmende Bebauung des Gebietes nördlich der Hagener Straße – Land, das der Herr von Haus Letmathe, Carl Overweg, als Bauland zur Verfügung stellte. Teile der heutigen Innenstadt stehen auf dem ehemaligen Hofkamp von Haus Letmathe.
Das älteste Haus an der Hagener Straße war natürlich Haus Letmathe. Auch viele Häuser im oberen Teil – wie etwa die Gaststätten Humpert und die noch heute existierenden „Altdeutsche Bierstuben“ – waren sehr alt. Anders auf dem unteren Teil: „Auf der Strecke zwischen der heutigen Bahnhofsstraße und der heutigen Straße ,Alter Markt’ ist noch kein einziges Haus eingezeichnet, wie aus einer Karte aus dem Jahr 1821 ersichtlich ist. Das älteste Haus an der Südseite der Hagener Straße dürfte das Haus von Uhren Krämer sein, das 1835 von Engelbert Korte erbaut wurde und bis zum Jahr 1937 im Besitz der Familie Korte blieb. Ebenso alt war das Haus der Familie Brauckhage, das im Jahr 1934 abgebrochen wurde. An seiner Stelle errichtete Franz Kurzhöfer ein modernes Geschäftshaus. Zu den ältesten Häusern an der Südseite der Hagener Straße gehörte ferner ein kleines Haus, das 1954 abgebrochen wurde, um einem Neubau des Café Schmale Platz zu machen. Auf ein hohes Alter können zwar auch einige der anderen Gebäude zurückblicken; der ,Bauboom’ aber setzte erst um die Jahrhundertwende ein, als die Südseite zum Herzstück der Geschäftsstraße Hagener Straße wurde. Diese Vorrangstellung behielt sie viele Jahrzehnte, bis vor rund 20 Jahren eine intensive Geschäftshaus-Bebauung der Nordseite einsetzte.“11 Bis Anfang des 20. Jahrhunderts reichten im nördlichen Teil Letmathes die Wiesen und Felder noch bis an die Hagener Straße, eine Böschung bildete die Grenze.

1868 erhielt die Hagener Straße als erste Straße in Letmathe eine Straßenbeleuchtung. Es wurden Laternen, deren Pfähle von Carl Overweg bezahlt wurden, aufgestellt.12
Im Jahr 1900 wurde dann ein Bürgersteig („Trottoir“) durch das Letmather Tiefbaugeschäft Friedrich Wilhelm Kathagen errichtet.13
Ab 1901 wurden die Straßenbahnschienen durch die Straße gelegt: „Am 3. März 1901 wurde ein Streckenteilstück der Linie 1, von Letmathe-Iserlohn/Ostbahnhof, und kurz darauf am 10. März die 3,2 Kilometer lange Abzweigstrecke von Grüne/Ellebrecht – Nachrodt dem Verkehr übergeben.“14 Die Stromleitungen über dem Schienenverlauf bestimmten das Straßenbild über Jahrzehnte hinweg ein gutes Stück mit.
1903 wurde das Amt Letmathe-Oestrich gebildet, die Amtsverwaltung war zunächst im Haus Bormann an der Hagener Straße untergebracht.15 Das Rathaus wurde dann zwischen 1903 und 1904 an der Hagener Straße gebaut.
Im August 1907 wurde die Genehmigung zur Verlegung von Elektrizitäts-Kabeln innerhalb der Bürgersteige der Hagener Straße erteilt.16 Im Laufe der Jahre wurden die Trottoirs arg belastet, 1911 waren die Bürgersteige zu stark beschädigt und mussten instand gesetzt werden. Die Hemeraner Firma Adolfs erhielt den Zuschlag, was innerhalb der Letmather Bürgerschaft für Unmut sorgte.17
Im Jahr 1908 war die Pflasterung der Fahrbahn Hagener Straße so schlecht, dass sie nach einhelliger Meinung eine Gefahr für Leben und Eigentum darstellte. Besonders die Gleise der Straßenbahn hätten, so die Bürgerschaft, daran Schuld. Und schnell erklärte sich auch die Westfälische Kleinbahn, wie der Vorläufer der Iserlohner Kreisbahn und der MVG damals hieß, bereit, den Schaden auszubessern.18
1913 baute Hermann Wrede ein neues Haus an der oberen Hagener Straße. Daraufhin musste ein Stück des Kanalsystems erneuert werden. Man setzte einen Vertrag zwischen Hermann Wrede, der politischen Gemeinde und dem Rittergutbesitzer Fritz Overweg auf, um die Kosten dafür zu regeln.19
Zwischen 1887 und 1930 wurde der untere Teil der Hagener Straße immer weiter ausgebaut. Das funktionierte Ende der 20er Jahre vor allem deshalb sehr gut, weil es Pläne der Westfälischen Kleinbahn zur Verlegung eines zweiten Gleises auf der “Barmen-Hagen-Wimberner Provinzialstraße“ wegen des gesteigerten Verkehrsaufkommens gab. Auch die Gemeinde und der Bürger- und Verkehrsverein begrüßten dieses Vorhaben. Der Verein schlug vor, den Fahrdamm um 11/2 Meter auf der Südseite zu verbreitern, um Raum für das Doppelgleis zu schaffen, das dann inmitten der Straße liegen würde. Ein großer Vorteil für die Gemeinde wäre es, dass dann gleichzeitig auch der Bürgersteig saniert werden könnte. In den folgenden Jahren gab es Streit wegen der Kosten, doch als man 1928 angesichts des hohen Verkehrsaufkommens sogar überlegte, die Hagener Straße in Richtung Iserlohn in eine Einbahnstraße zu verwandeln, nahmen die Pläne immer konkretere Formen an. Der Vorschlag sah dann so aus, dass die Straße insgesamt auf elf Meter verbreitert werden sollte. Die Westfälische Kleinbahn sollte 4,5 Meter unterhalten, die Gemeinde sollte den Grunderwerb und die Kosten für den Bürgersteig und andere Bauarbeiten tragen. Eine Folge war dann, dass einige der kleinen „Mäuerkes“ vor den Häusern verschwinden mussten. Die kleinen Mäuerchen dienten der Abgrenzung vor den Häusern. Diese vorspringenden Einfriedungen mussten bei den Häusern Homberg, Vieler, Schreiber und Steinschulte zurückgesetzt werden. An den Besitzungen Willmes und Koppel mussten Freitreppen beseitigt werden.
Zwischen 1925 und 1929 erhielt auch der obere Teil der Hagener Straße im Bereich des Krankenhauses eine Pflasterung.20 Das zweite Gleis wurde dann gebaut, es verlief von den Gaststätten Erbeling bis Steinschulte.
1928 verlegte man Gasversorgungsleitungen in der Straße. Kleine Holzbrücken sorgten dafür, dass die Fußgänger während der Bauarbeiten über die hochgebockten Rohre hinweg die andere Straßenseite erreichen konnten.21 Im Jahr 1929 wurden die Laubbäume im nördlichen Teil der Straße gefällt.
Während der Nazi-Zeit wurde die Hagener Straße 1937 in „Adolf-Hitler-Straße“ unbenannt, was nach dem Kriegsende 1945 wieder rückgängig gemacht wurde. Sie war Teil der Reichsstraße 7.
1935 wurde der Hauptsammelkanal der Hagener Straße von der Friedhofstraße bis zum alten Friedhof verlängert. Die Letmather Firma Dietrich Laurenzis Baumaterialien lieferte das Material im Oktober 1935, ebenso die Letmather Eisengießerei und die Maschinenfabrik Schütte, Meyer & Co. Die Arbeiten nahm die Firma Aloys Leonard Hoch- und Tiefbau aus Letmathe vor.
Im Laufe der Jahre wandelte sich durch diese baulichen Maßnahmen die dörfliche Idylle der Hagener Straße. Um 1938 wurde zunächst eine Ferngasleitung verlegt, die Bauarbeiten zogen die Straße sehr in Mitleidenschaft, sie musste mal wieder ausgebessert werden.22 Ab 1948 – in der Zeit des Wirtschaftswunders – wurde das Gesicht der Straße weiter modernisiert. Werner Weber: „Die Bebauung wurde stärker und fast lückenlos reihten sich die Häuser aneinander.“23 Auch die Schaufensterscheiben wurden vergrößert, manches altes Haus wurde dadurch in der unteren Etage hochmodern, während die darüber liegenden Etagen noch Fachwerk- oder Jugendstilelemente zeigten. Der Verkehr, der schon längst von Pferdekutschen auf Autos umgestellt war, wurde zudem immer dichter, „so dass man zunächst mit markierten Fußgänger-Überwegen“24 das Überqueren der Straße sicherer machte.
1956 war die Hagener Straße mittlerweile sogar 15 Meter breit.25 1957 fand eine Verkehrszählung statt. „Vor zwei Jahren wurden an einem Tag zwischen 7 und 21 Uhr 9513 Fahrzeuge aller Art gezählt. Inzwischen ist die Zahl bereits auf 10 906 Fahrzeuge an einem Tag gestiegen. Das bedeutet also, dass durchschnittlich alle 4 ? Sekunden etwa ein Fahrzeug über die Hagener Straße fährt und damit einen erhebliche Verkehrsdichte, einen zu verschiedenen Zeiten fast lückenlosen Fahrzeugstrom!“26
1959 endete die Straßenbahn-Ära, die Strecke wurde in der Silvester-Nacht stillgelegt.27

1963 wurde die mittlerweile stillgelegte Gas-Versorgungsleitung aus der Straße herausgenommen. Ein mächtiges Kanalrohr trat an ihre Stelle.28 1965 wurde die Straße erneut umgestaltet, neue Markierungen wurden angebracht, Rohre verlegt und die Bäume mit der runden Krone wurden abgeholzt. Das Kopfsteinpflaster wurde zudem entfernt und neue Gehwege angelegt. Ferner wurde die Mauer vor Haus Letmathe abgerissen, ebenso die Besitzung Hagener Straße 44 bis 46 (Schneider Wilms). Ab Juli 1966 konnten Fußgänger durch Ampeln geschützt die Straße überqueren.29 Im selben Monat führte man auch eine „grüne Welle“ bei den Ampeln der Straße ein.30 In den 60er Jahren stellte man Parkuhren in der Straße auf. Ab August 1971 gab es verstärkt Bemühungen, die Straße zum fahrzeugfreien Einkaufszentrum umzuwandeln. Regelmäßig meldete damals der Verkehrsfunk an Feiertagen Verkehrsstockungen „im Raum Letmathe auf der B 7/236“. Schon an normalen Tagen quälten sich 20.000 Fahrzeuge durch die Hagener Straße.31 Doch die Pläne zur Entlastung der Innenstadt wurden nur langsam und nur zum Teil umgesetzt.
Ab 1974 erhielt die Hagener Straße ein komplett neues Gesicht: Es fielen am Alten Markt viele Häuser dem Straßenbau zum Opfer, um die Kreuzung zu verbreitern. Zuerst wurden die Geschäfte „Herrensalon Schröder“, „Lebensmittel Kurz“ und „Bäckerei Röhre“ abgerissen, 1976 folgten der Gasthof „Deutsches Haus“ (Liese), die Besitzung Brieden und die Gaststätte Humpert. Als letztes Haus wurde 1983 die Metzgerei Schlüter abgebrochen. Zudem wurden zwischen Schwerter Straße und Bahnhofsstraße die Straßenbäume zwecks der Anlage von Parkplätzen gefällt.32 Auch wenn durch die Baumaßnahmen ein Stück alte Hagener Straße verloren ging: Die Neuordnung des Alten Marktes sowie der Bau der Umgehungsstraße an der Lenne entlang und der Bau der Autobahn entlasteten die Hagener Straße enorm, das Verkehrsaufkommen war in den 60-er und 70-er Jahren sehr groß gewesen.
1986 wurde erneut an der Hagener Straße gebaut, diesmal wurde in dem Bereich zwischen Schwerter Straße und Bahnhofsstraße eine Fußgängerzone eingerichtet. Zum Teil konnte die Hagener Straße aber auch weiterhin befahren werden, allerdings als Einbahnstraße (von unten bis zur Einmündung Marienstraße und von oben über die Marktstraße hinein und über die Marienstraße wieder heraus) und nur im Schritttempo. Am Alten Markt wurde die Straße komplett für die Ein- und Ausfahrt geschlossen, man bildete dabei sozusagen auch eine Barriere zwischen dem historischen Zentrum Letmathes und dem neuen Ortskern. Im ganzen, 1987 gestalteten Fußgängerzonen-Bereich wurden zudem wieder Straßenbäume gepflanzt.33 Auch wurden die – ohnehin eigentlich schon recht breiten – Bürgersteige weiter vergrößert.34 1988 feierten die Letmather „175 Jahre Hagener Straße“ mit einem Straßenfest und einem Sonderdruck der Letmather Nachrichten.
Vor einigen Jahren wurden die Parkuhren abgeschafft, seitdem gibt es Parkautomaten.
Im August 2003 wurden im unteren Teil der Hagener Straße (Höhe Adler-Apotheke) einige Parkplätze schräg angeordnet. Das waren schon Vorbereitungen für Pläne der Stadtverwaltung, die Straße von einer Schritttempo-Zone in einen „verkehrsberuhigten Geschäftsbereich“ umzuwandeln. Im Januar 2004 war es dann soweit: Jahrelang durfte bis dahin zwischen dem „Alten Markt“ und den „Poststuben“ nur Schritttempo gefahren werden, nun änderte sich das: Die Straße wurde zum „verkehrsberuhigten Geschäftsbereich“, von da ab herrschten zwei Tempozonen an der Hagener Straße. Zwischen Dierkes und den „Poststuben“ darf (höchstens) Tempo 20 gefahren werden. Für den Einbahnstraßenbereich zwischen Dierkes und „Alter Markt“ wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h angeordnet.35
Die Hagener Straße ist in fast 200 Jahren zum Mittelpunkt Letmathes geworden. Hier findet man die wichtigsten Banken, das alte Rathaus mit der Polizeistation, das Krankenhaus und Haus Letmathe. Auch die liebevoll im Volksmund „Dom“ genannte Kilianskirche prägt – auch wenn sie ein Stück abseits der Hagener Straße steht – das Straßenbild enorm mit. Viele Umzüge und Veranstaltungen (Schützenfestzüge, historische Festzüge, Militäraufmärsche, religiöse Prozessionen, Märkte) hat die Straße erlebt, das bürgerschaftliche Leben spielte sich zu einem sehr großen Teil auf ihr ab.
1 Letmather Nachrichten (Hrsg.): Letmathe 950 Jahre. Letmathe, 1986. S. 27. Auch in: 250 Jahre Postgeschichte in Jahresdaten. In: Förderkreis Iserlohner Museen (Hrsg.): Jahresschrift 1983. Iserlohn, 1983. S. 101 – 102.
2 Originaldokument im Fürstlichen Archiv zu Rheda. Zitiert bei: Esser, Hermann: Heimische Straßengeschichte. 1. Die Chaussee von Hagen nach Iserlohn. In: Heimatblätter für Hohenlimburg und Umgegend.7.Jahrgang, Heft Nr. 8. August 1933. S.115. Ebenfalls zitiert bei: Lürmann, Werner: Wegezoll und Brückengeld, Straßenverhältnisse und Postwesen in der Grafschaft Limburg im 18.Jahrhundert. In: Heimatblätter für Hohenlimburg und Umgegend.16.Jahrgang,1955. Nr.1.S.3.
3 Esser, Hermann: Heimische Straßengeschichte. 1. Die Chaussee von Hagen nach Iserlohn. In: Heimatblätter für Hohenlimburg und Umgegend. 7. Jahrgang, Heft Nr. 8. August 1933. S. 118/119.
4 Lürmann, Werner: Wegezoll und Brückengeld, Straßenverhältnisse und Postwesen in der Grafschaft Limburg im 18. Jahrhundert. In: Heimatblätter für Hohenlimburg und Umgebung. 16. Jahrgang, 1955. Nr. 1. S. 2.
5 Bornefeld, Paul: Aus der Geburtsstunde der Bundesstraße 7. In: Heimatblätter für Hohenlimburg und Umgebung. 29.Jahrgang, Heft Nr. 2, Dezember 1968, S.240.
6 Siehe Breithaupt, H.: Poststation Wimbern 1816-1870. In: Verein für Geschichte und Heimatpflege Wickede (Ruhr) (Hrsg.): Information für Heimatfreunde. Ausgabe Juni 1991, Heft Nr. 17. Auch in: Gesellschaft für Deutsche Postgeschichte (Hrsg.): Postgeschichtliche Blätter. Bezirksgruppe Dortmund. April 1962.
7 Letmather Nachrichten (Hrsg.): Letmathe 950 Jahre. Letmathe, 1986. S. 28.
8 Letmather Nachrichten (Hrsg.): 175 Jahre Hagener Straße. Sonderdruck. Letmathe, 1988.
9 Bönemann, Theo: Post im Sauerland. Menden, 1993. S. 77.
10 Esser, Hermann: Heimische Straßengeschichte. 1. Die Chaussee von Hagen nach Iserlohn. In: Heimatblätter für Hohenlimburg und Umgegend. 7. Jahrgang, Heft Nr. 8. August 1933. S. 117/118.
11 Weber, Werner: An der Chaussee entstand ein modernes Einkaufszentrum. In: Letmather Nachrichten. 3. September 1986.
12 Letmather Nachrichten (Hrsg.): 950 Jahre Letmathe. Letmathe, 1986. S. 39.
13 Stadtarchiv Iserlohn. Bestand Letmathe C1, Nummer 1040.
14 Müller, Peter / Stalp, Günter: Unsere gute alte Straßenbahn. Iserlohn, 1996. S. 11.
15 Letmather Nachrichten (Hrsg.): 175 Jahre Hagener Straße. Sonderdruck. Letmathe, 1988.
16 Stadtarchiv Iserlohn. Bestand Letmathe C1, Nummer 358.
17 Stadtarchiv Iserlohn. Bestand Letmathe C1, Nummer 1040.
18 Zeitungsartikel und Brief der Westfälischen Kleinbahn im Stadtarchiv Iserlohn, Bestand Letmathe C1, Nummer 176.
19 Stadtarchiv Iserlohn. Bestand Letmathe C1, Nummer 1040.
20 Stadtarchiv Iserlohn. Bestand Letmathe C1, Nummer 1040.
21 Iserlohner Kreisanzeiger. 1. Mai 1963.
22 Letmather Nachrichten (Hrsg.): 175 Jahre Hagener Straße. Sonderdruck. Letmathe, 1988.
23 Werner Weber: Hagener Straße spiegelt das Gesicht der Stadt. In: Letmather Nachrichten. 19. Oktober 1957.
24 Letmather Nachrichten (Hrsg.): 175 Jahre Hagener Straße. Sonderdruck. Letmathe, 1988.
25 Letmather Nachrichten (Hrsg.): Schönes Letmathe im Sauerland. Strukturbild einer jungen, aufstrebenden Stadt. Letmathe, 1956. S. 84.
26 Letmather Nachrichten. 19. Oktober 1957.
27 Müller, Peter / Stalp, Günter: Unsere gute alte Straßenbahn. Iserlohn, 1996. S. 147.
28 Iserlohner Kreisanzeiger. 1. Mai 1963.
29 Stadt Letmathe (Hrsg.): Stadt Letmathe 1956 – 1971. Letmathe, 1071. S. 26.
30 Iserlohner Kreisanzeiger. 27. Juli 1966.
31 Stadt Letmathe (Hrsg.): Stadt Letmathe 1956 – 1971. Letmathe, 1071. S. 26.
32 Letmather Nachrichten (Hrsg.): 950 Jahre Letmathe. Letmathe, 1986. S. 30.
33 Letmather Nachrichten (Hrsg.): Letmathe 950 Jahre. Letmathe, 1986. S. 30.
34 Letmather Nachrichten (Hrsg.): 175 Jahre Hagener Straße. Sonderdruck. Letmathe, 1988.
35 Iserlohner Kreisanzeiger. 19. Januar 2004.
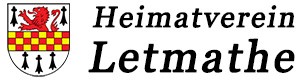
Als ehemaliger Versicherungskaufmann im Außendienst gehörten zu meinen Aufgaben auch die Gebiete Letmathe, Iserlohn, Hemer etc.
Ich kann mich aber noch an die Zeit erinnern, wo man wegen einem FELSEN auf der Straße vor Iserlohn diesen umfahren mußte ?
Lieder finnde ich darüber nichts in Ihren Unterlagen.- gibt es darüber evtl. noch Bilder dieser Straße ?
Herzlichen Dank im Voraus.
Antwort per E-Mail. webmaster heimatverein-letmathe.de